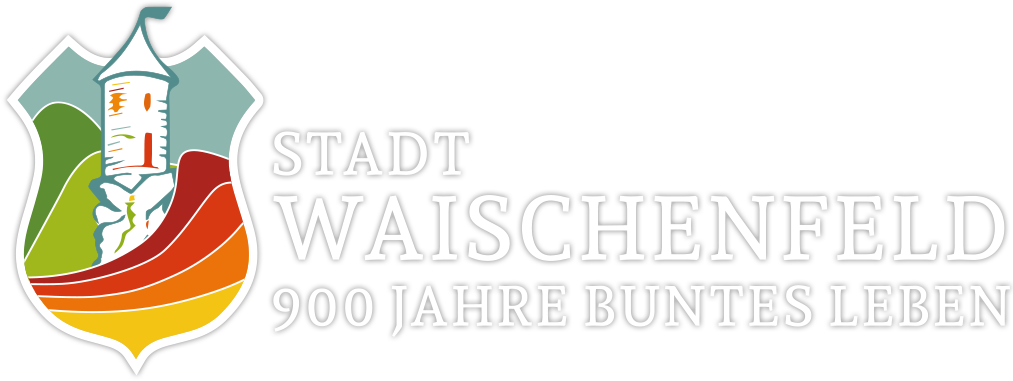Löhlitz
Löhlitz ist ein Ort mit einer interessanten und für unsere Landschaft charakteristischen Geschichte. Der Ortsname (1380 Lelaycz, 1398 lelaz, 1422 leleitz, leletz, 1452 Lelicz, seit 1692 als Löhlitz urkundlich überliefert) ist slawischen Ursprungs und bedeutet „Leute, Angehörige des Lelek“. Er war der namengebende Anführer jener slawischen Familien, die sich hier niedergelassen haben.. Wann dies geschehen ist, kann man nur vermuten. Jedenfalls wurden im Mittelalter Slawen als geschickte Rodungsbauern angeworben und häufig bei uns angesiedelt.
Die „Slawengräber“ am Löhlitzer Anger haben aber nichts mit ihnen zu tun, denn sie stammen aus der vorgeschichtlichen Eisenzeit des 6. Jhdts. v. Chr. Damals hat man die Toten in Grabhügeln bestattet. Die Siedlung dieser Menschen wird nicht weit davon entfernt gewesen sein. Der Grund, warum man schon zu dieser frühen Zeit, aber auch im Mittelalter hier gesiedelt hat, liegt vermutlich im Vorkommen von Eisenerz. Die Grubenlöcher dicht beim Oberndorf, die langen Gräben im Löhlitzer Holz, die Holzkohlenreste und Schlackenhaufen vor allem im Bereich des Oberndorfs sind Zeugnis dafür. Ob die Sagen von den „Wilden Leuten“ im Oberndorf eine Erinnerung an den Eisenabbau und die Verhüttung darstellen, kann man nur vermuten. Der Eisenerzabbau im Waischenfelder Gebiet und um die Neubürg hat etwa im hohen Mittelalter begonnen und läßt sich bis ins 17. Jhdt. hinein belegen. Eisenerzverhüttung war Privileg des Landesherrn und auf das Vorhandensein der großen Forste angewiesen.
Zum Transport dieses wichtigen Rohstoffes waren günstige Verkehrswege notwendig. Nördlich von Löhlitz verläuft die Kriegsfuhr, eine alte Heerstraße. Sie kommt aus dem Raum Aufseß-Hochstahl, führt bei der Eichenmühle über die Wiesent, zieht bei der Roten Marter vorbei und führt am Wegekreuz beim Oberndorf und über den Holomann ins Ahorntal. Ein weiterer alter Fernweg ist die „Gutengaß“, die als Judengasse von der Kriegsfuhr abzweigt und knapp nördlich des Ortes über den Theuerrangen in Richtung Neusig verläuft. Eine dritte Altstraße, ihrem Verlauf nach wohldie älteste, kommt aus Südwesten, führt am Löhlitzer Rangen,vorbei an den Hügelgräbern,zum Holomann und weiter in Richtung Wohnsgehaig. Zum Schutz dieser Altstraßen, aber auch der Erzabbaustätten, hat man schon frühzeitig Befestigungsanlagen errichtet. Eine solche ist die seit 1594 urkundlich erwähnte Bürg, auch Vogelsburg genannt. Auch das Dürrnbührlein wird eine „Turmburg“ gewesen sein. Von der Burganlage bei der Holomannskapelle sind Erdwall und Graben noch heute zu erkennen. In Verbindung mit den Wehranlagen steht die Wacht als Signal- und Beobachtungsposten. Auch in Löhlitz selbst befanden sich zwei Schlösser, die ursprünglich befestigt waren, wie man auf der Kartenzeichnung von 1718 noch deutlich erkennen kann. Die Sage vom Streit der beiden Schloßherren miteinander errinnert daran. Das „alte Schloß“, eine Turmhügelburg am Südrand von Löhlitz, war ein Wasserschloß und stand an der Stelle von Haus Nr.38. Die Sage von einem unterirdischen Gang zum Burgstuhl bei Volsbach spricht für einen Ansitz der edelfreien Herren von Volsbach, die auch der Vogelsburg ihren Namen gegeben haben. Noch 1453 im Besitz des Contz von Christanz, wurde die Anlage sicher von den Hussiten 1430, aber auch im Bauernkrieg 1524 zerstört. Ein ähnliches Schicksal hatte das zweite jüngere und unbefestigte Schloß im Bereich der Hausnummern 4 und 5. In der Zeichnung von 1718 ist der doppelgieblige Renaissancebau mit der Mauer darum gut zu erkennen. Nach der Zerstörung war es 1556 wieder aufgebaut worden. Später finden wir die Herren von Egloffstein als Erben der Groß in Löhlitz. Die adeligen Schlösser und Güter waren Lehen vom Landesherrn, dem Bischof von Bamberg. Aufgabe des Adels war der militärische Schutz der Straßen und der Abbaugruben.
Aber noch eine weitere Funktion war hier in Löhlitz zu erfüllen: Löhlitz ist ein uralter Grenzort, wenngleich dies in unserer Zeit, vor allem seit der Gebietsreform, nicht mehr so deutlich wird wie früher. Diese alte Grenze zwischen dem Hochstift Bamberg und der Markgrafschaft Bayreuth war vor allem seit der Reformation auch eine scharfe Konfessionsgrenze. Jenseits begann eine „neue Welt“. Innerhalb der Hochstiftsgrenzen berührten sich die bischöflichen Verwaltungsbezirke der Ämter Waischenfeld, Hollfeld-Königsfeld und ihren Pfarrsprengeln. Auf dieser alten Grenze beruhte auch das Dreiländereck der alten Landkreise Ebermannstadt, Pegnitz und Bayreuth. Grundlage dieser Grenze waren die Territorien der Herren von Schlüsselberg, der Walpoten von Zwernitz, der Bamberger und Bayreuther Landesherren. Grenzanzeigende Flurnamen finden sich im Teufelswinkel und dem Ringau (Rain), der „breite Schlag“ als Grenzschneise begleitet die alte Straße zur Holomannskapelle, immer entlang der Gemeindegrenze. Im Süden bildet der Schlegelberg, wo die Grenze „ausgeschlegelt“ wurde, die Grenze. Die Rote Marter am Schnakeneck markiert das Grenzgebiet nach Hollfeld hin. Die Sagenüberlieferung von einer Bluttat und die Erscheinung eines „Mannes ohne Kopf verweisen auf die Hoch- und Blutgerichtsgrenze. Auch wo das „wütende Heer“ tobt, befinden sich solche markanten Grenzpunkte. Sein Anführer Wotan galt in vorchristlicher Zeit als Hüter der Grenze. So kommt das „Wütendkehr“ zur Dreifaltigkeitsmarter. Ähnlich verhält es sich mit dem „schwarzen, feurigen Hund“ am Kieberloch, der auch zu den sagenhaften Grenzwächtern gehört. Der „hunto“ (althochdeutsch) war aber als adeliger Verwaltungsbeamter auch für den Schutz der Gerichtsgrenzen zuständig. Seine Bezeichnung als „Schultheiß“ belegt dies im Zusammenhang mit dem Schafhof, wo der Sitz eines solchen gewesen war. Aber auch die Löhlitzer Bauern hatten eine wichtige und interessante Aufgabe: Als Rodungssiedler des Landesherrn waren sie mit besonderen Privilegien ausgestattet. Ihre Aufgabe lag in der Waldwirtschaft, u.a. in der Nutzung der Zeidelweide (Honig- und Wachsproduktion) für den Landesherrn. Das System der Forstverwaltung des Mittelalters wird in Löhlitz an der „Vorstube“, d.h. der Forst-Hufe, 1398 auch „Riesenhub“ genannt, deutlich. Sie ist als Betriebseinheit doppelt so groß wie bäuerliches Eigentum. Daß die „Leute des Lelek“, als Genossenschaft hier angesiedelt wurden, belegt die Existenz der „Landsgemeinde“, die sich heute noch im Flurbild erkennen lässt.